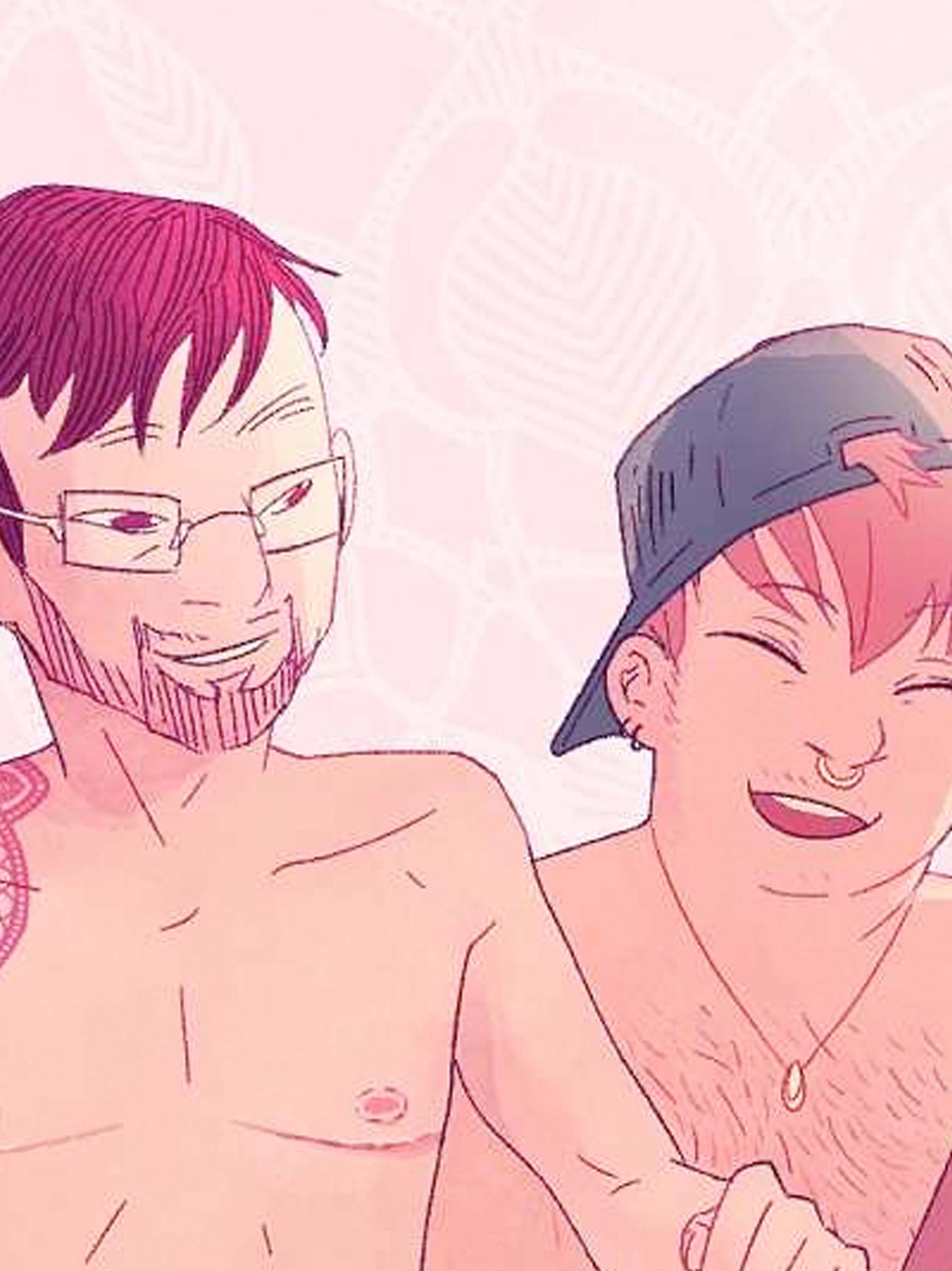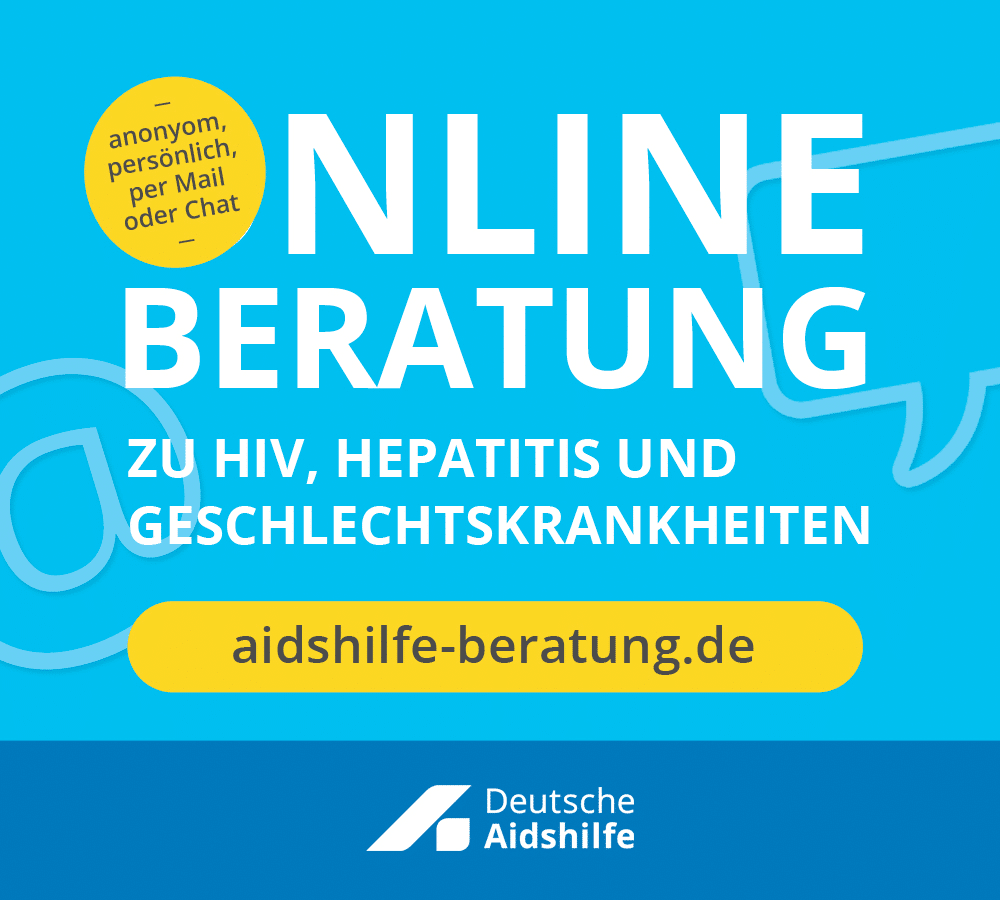Im Interview spricht er über die Überlastung, den Alltag in der Tagesklinik und die Auszeiten, die er sich heute gönnt.

René, du hattest vor einigen Jahren ein Burn-out. Was war der Grund dafür?
Mein Burn-out kam durch den Job: ich war absolut unzufrieden auf der Arbeit und hatte gleichzeitig so viel zu tun, dass es für drei gereicht hätte.
Was waren die Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmte?
Da gab es viele: Nachts konnte ich nicht schlafen, weil die Gedanken kreisten. Tagsüber war ich total müde, sodass ich unkonzentriert war und nicht mehr viel schaffen konnte. Zudem hatte ich auch Migräneanfälle oder Schwindelattacken mit dem Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen.
Mein Privatleben bestand eigentlich nur darin, auf der Couch zu liegen und zu versuchen, Schlaf zu bekommen. Ich hab mich auch von meinen Freunden komplett abgeschottet.
Ab wann war klar: So geht’s nicht weiter?
Das war erst mal gar nicht so klar. Von den ersten Anzeichen bis zu dem Punkt, wo ich mir sagte, „Jetzt muss was passieren!“, sind eineinhalb Jahre vergangen. Ich bin also eineinhalb Jahre durch die Gegend gewandelt wie ein Zombie. Ich wollte und konnte einfach nicht mehr. Aber ich wollte meine Kraft zurückhaben. Ich wollte wieder „ich“ sein …
Wie hast du das geschafft?
Irgendwie hab ich da ganz logisch gedacht: Welche Möglichkeiten habe ich bei mir in der Nähe? Ich bin dann durchs Internet gesurft und habe nach „Psychologe“ und „Psychiater“ und „Einrichtungen Burn-out“ gesucht.
Und dann?
Habe ich bei einer psychiatrischen Institutsambulanz angerufen, um ein Erstgespräch zu vereinbaren. Ich hatte alle meine Hoffnungen darauf gesetzt. Und war nach dem Gespräch auch richtig erleichtert. Vorher dachte ich noch, die sagen jetzt „Sie sind verrückt“ oder so was.
Im ersten Gespräch wurden mir dann die Möglichkeiten aufgezeigt, die für mich in Frage kamen: Das ging von einer Gesprächstherapie über eine Akutklinik bis hin zu Psychopharmaka. Vor den Pillen hatte ich am meisten Schiss. Nach einem zweiten Gespräch eine Woche später war klar, ich will in eine Tagesklinik. Und eine weitere Woche später war klar: ich nehme auch Pillen.
Was hast du in der Tagesklinik gemacht?
Wie der Name schon sagt, war ich tagsüber in dieser Einrichtung und wurde dort betreut. Zunächst ging es darum, sich und seinen Alltag wieder zu strukturieren. Wir haben zum Beispiel gemeinsam gefrühstückt und zu Mittag gegessen – inklusive der Küchendienste. Oder wir haben Ausflüge oder Sport gemacht. Dann gab es eine Gesprächstherapie und eine Kunsttherapie, in der ich angefangen habe, zu malen.
Ab wann hast du gemerkt, dass es wieder bergauf geht?
Das ging nicht von heute auf morgen. Aber nach drei bis vier Wochen in der Klinik merkte ich, es passiert etwas. Die Tabletten wirkten und ich hatte das Gefühl, ich bin nicht alleine. Es gibt andere, denen es so scheiße geht wie mir.
Und so ging es Schritt für Schritt weiter. Nach 11 Wochen in der Tagesklinik fand eine stufenweise Wiedereingliederung in meinen Job statt. Parallel habe ich einen Reha-Antrag gestellt, um meine Psyche dauerhaft zu stabilisieren. Nach zwei Monaten Reha wurde vieles anders: Ich habe meinen alten Job gekündigt, habe angefangen, Sozialpädagogik zu studieren, und bin dafür auch in eine andere Stadt gezogen.
Wie geht’s dir heute?
Mir geht’s gut! Und ich bin irgendwie auch etwas froh über diese Erfahrung. Klar, ich weiß nicht, wie mein Leben aussehen würde, wenn mir das Ganze nicht passiert wäre.
Für mich hat sich auf jeden Fall viel verändert. Ich hab nicht nur ein neues Studium begonnen, ich habe heute auch eine andere Sichtweise auf Geld oder Statussymbole. Klar gönne ich mir auch was, aber das bedeutet mir heute weniger als früher. Insgesamt war der Burn-out einschneidend. Heute sage ich, es ist nicht schlechter als vorher, es ist anders.
Freunde sind total wichtig. Auch wenn ich mich erst von allen Freunden zurückgezogen habe, hab ich im gesamten Prozess doch gesehen, wer ist da und versucht, eine Stütze für mich zu sein. In der Tagesklinik habe ich auch zwei Leute kennengelernt, denen es genauso dreckig ging wie mir. Wir haben uns gleich super verstanden. Da war absolutes Vertrauen, die konnten nachvollziehen, wie es mir geht. Da war sofort eine gute Freundschaft – und die besteht immer noch.
Was mir auch gut tut ist die ehrenamtliche Arbeit, unter anderem für ICH WEISS WAS ICH TU. Das gibt mir Struktur und ich bin gleichzeitig raus aus dem Alltag. Und ich höre viel mehr auf mich und meine Signale als früher.
Was heißt das?
Ich geh auf meine Bedürfnisse ein. Ich nehme mir Auszeiten, wenn ich sie brauche. Dann fahr ich eine Stunde mit dem Fahrrad oder setz mich mit einem Buch in den Park oder stell einfach mal das Handy aus. Früher wär ich mit Freunden rausgegangen, auch wenn ich keinen Bock drauf hatte. Das mach ich heute nicht mehr.
Warum redest du so offen über deine Geschichte?
Weil es ein Tabuthema ist, obwohl es keins sein sollte. Wenn man sich ein Bein bricht, geht man zum Arzt. Und psychische Erkrankungen lassen sich auch behandeln. Trotzdem hört man immer noch Sprüche wie „Das geht schon wieder!“, „Das ist nicht so schlimm!“ oder „Ich bin ja keine Memme!“ So eine Einstellung kotzt mich an. Denn für psychische Probleme braucht sich keiner zu schämen.