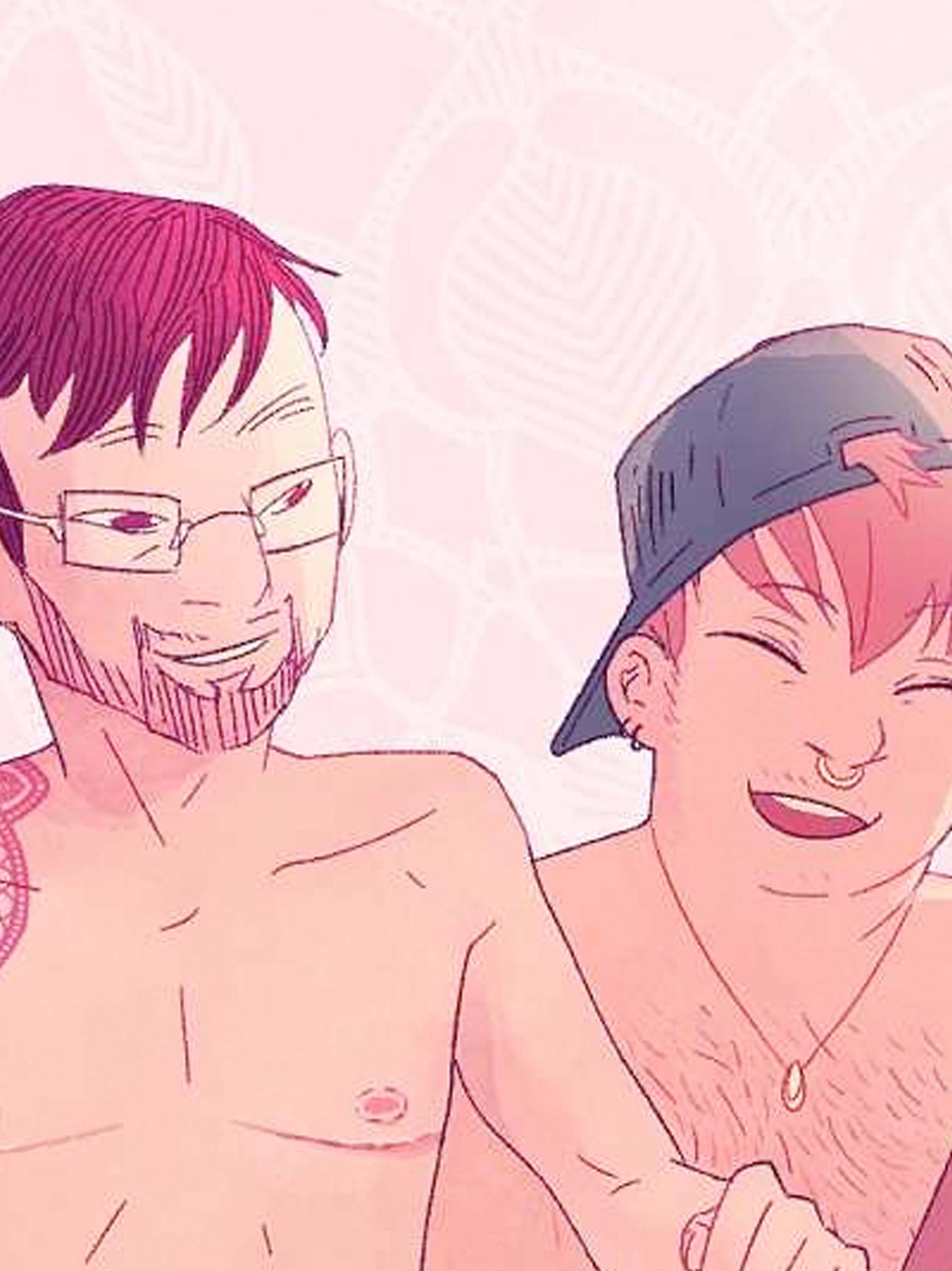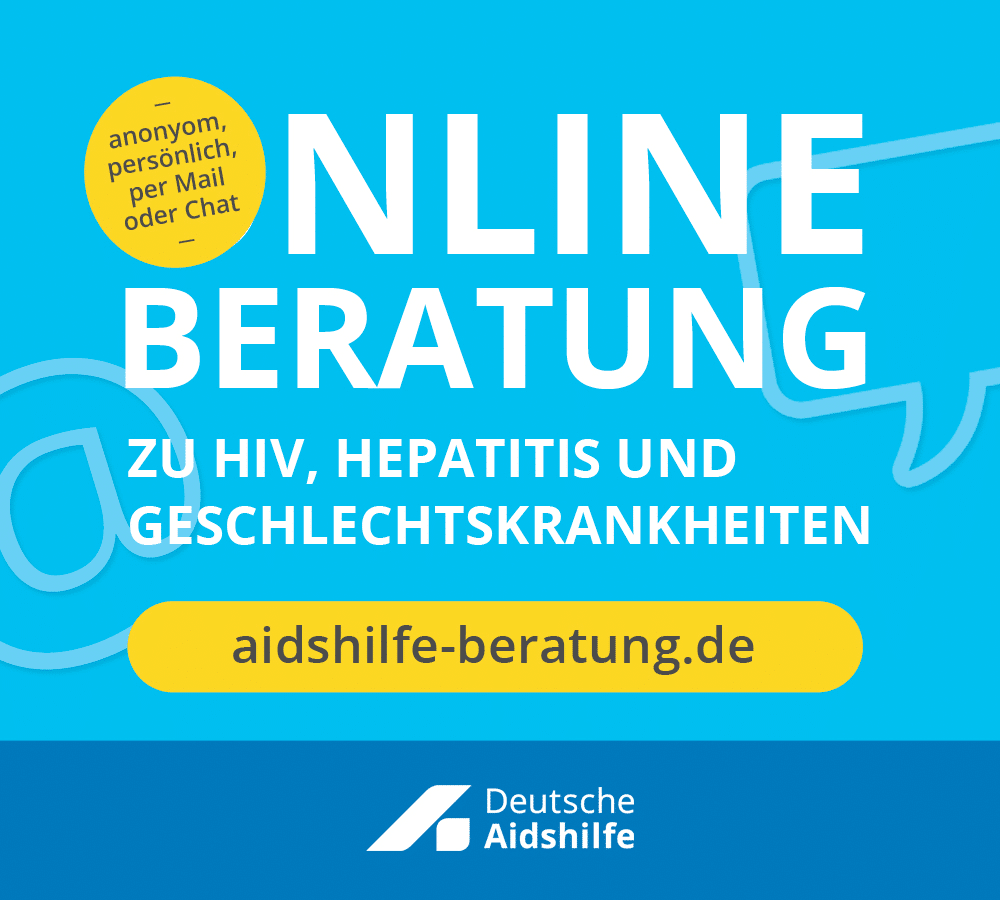Während in diesem Jahr kein einziger der über 400 ausgewählten Beiträge der Internationalen Filmfestspiele Berlin sich dezidiert mit HIV und Aids auseinandersetzt, erzählen rund 60 Filme von LGBT-Ikonen, Sexarbeit und Trans*menschen. Hier eine kleine aber feine Auswahl:

Michael ist fast so etwas wie ein Vorzeige-Schwuler: smart, gutaussehend, glücklich liiert und ein leidenschaftlicher LGBT-Aktivist, der sich besonders für lesbisch-schwule Jugendliche einsetzt. Aber all das vermag diese Leere nicht zu füllen, die er nach einem Herzanfall in sich spürt.
Der Atheist Michael sucht nach dem Sinn des Lebens – und wird fündig im christlichen Glauben. Mehr noch: Er beginnt die Homosexualität als unchristlich zu verdammen, erklärt sich kurzerhand als nunmehr heterosexuell und wird Prediger.
Diese Wandlung mag in der Kurzform reichlich unglaubwürdig klingen, ist aber die wahre Geschichte des Michael Glatze. Dessen 180-Grad-Wendung vom Kämpfer für LGBT-Rechte zum ultrakonservativen Priester hatte 2007 in den USA für großes Aufsehen gesorgt. Seine Freunde und Mitstreiter, nicht zuletzt sein langjähriger Lebensgefährte fühlen sich verraten.
Kirchenvertreter hingegen, die Homosexualität als selbstgewählte Verirrung betrachten, fühlten sich in ihrer Haltung bestätigt. Justin Kelly hat diese Geschichte nun verfilmt.
Auch wenn der Fall Michael Glatze hierzulande wenig bekannt ist, dürfte „I Am Michael“ auch bei uns für Diskussionen sorgen. Nicht zuletzt auch, weil Kelly keine eindeutige Haltung bezieht, also weder Michaels spirituelle Suche lächerlich macht, noch die Folgen ausspart, die seine Wandlung für die Menschen um ihn hat.
Das Drama gilt schon jetzt als einer der queeren Highlights im Programm der am 5. Februar beginnenden 65. Internationalen Filmfestspiele Berlin. Dafür spricht unter anderem die recht gradlinige Inszenierung und die namhafte Besetzung: James Franco („Milk“, „Howl“, „The Interview“) in der Titelrolle gilt längst als neue Queer-Ikone und ist zudem äußerst produktiv.
Mindestens ebenso viel Aufmerksamkeit wünscht man sich dem dokumentarischen Spielfilm „Stories of Our Lives“. Jim Chuchu zeigt in poetisch-klaren und ästhetisch überzeugenden Schwarz-Weiß-Bildern Alltagsepisoden aus Kenia. Das Besondere daran: Die fünf sehr unterschiedlichen Geschichten handeln vom Leben junger Lesben und Schwuler und wurden vom Künstlerkollektiv NEST während einer mehrmonatigen Interviewreise durch das Land gesammelt.
Sie erzählen in vielen Facetten von den Schwierigkeiten, in einer zutiefst homophoben Gesellschaft eine homosexuelle Identität aufzubauen. „Stories of Our Lives“ vermittelt zudem eindringlich die Angst dieser jungen Schwulen und Lesben, als Homosexuelle enttarnt zu werden. Denn selbst engste Freunde und die eigene Familie schrecken vor Gewalt nicht zurück. In einer der Episoden raubt diese Angst einer jungen Lesbe nachts den Schlaf. Stattdessen überlegt sie, was sie und ihre Lebensgefährtin an Nötigstem mitnehmen sollten, wenn sich der Mob vor ihrer Haustüre zusammenrottet, um sie zu vergewaltigen und totzuschlagen.
Es gibt aber auch anrührende Momente, wie die zarte Annäherung zweier junger Frauen oder die Bettszene zwischen einem britischen (weißen) Callboy und einem (schwarzen) kenianischen Freier, die sich beim Sex wechselseitig auf unterhaltsame Weise mit ihren Rassenvorurteilen konfrontieren.
Wie selbstverständlich und unproblematisch erscheinen da doch die schwulen Lebensentwürfe in einigen asiatischen Produktionen. In dem taiwanesischen Drama „Thanatos, Drunk“ von Tso-Chi Chang müssen zwei höchst unterschiedliche Brüder den Tod ihrer alkoholkranken Mutter bewältigen. Der eine, schwul und beruflich erfolgreich, ist nach einer zerbrochenen Beziehung wieder aus den USA nach Taipeh zurückgekehrt – und verguckt sich ausgerechnet in einen Hetero-Callboy. Der andere schlägt sich mit einem Gelegenheitsjob als Gemüsehändler durch.
Auch in Josh Kims indonesisch-taiwanesischer Produktion „How to Win at Checkers (Every Time)“ steht ein Brüderpaar im Zentrum. Der schwule Ek arbeitet in einer Stricher- und Transenbar und lebt seit der Schulzeit in einer scheinbar durch nichts zu erschütternden innigen Beziehung zu Jai. Auch der Klassenunterschied scheint ihrer Liebe nichts anhaben zu können – bis der jährliche Tag der Einberufung ansteht. Denn Jais reicher Vater kann seinen Sohn vom Militärdienst freikaufen.
In den USA haben Schwule hingegen ganz andere Probleme. In „Nasty Baby“ will sich der spanischstämmige Künstler Freddy (gespielt vom Drehbuchautor und Regisseur Sebastián Silva) unbedingt seinen Kinderwunsch erfüllen. Seinen Lebenspartner hat er bereits überzeugt, und die beste Freundin Polly will das Baby für sie zur Welt bringen. Was als neckische Komödie über die Befindlichkeiten der New Yorker Bohème beginnt, endet dann ziemlich überraschend in einem ernüchternden, blutigen Desaster.
In Étienne Faures „Bizarre“ findet nur ein paar Kilometer Luftlinie entfernt – im hippen, durch Gentrifizierung bedrohten Künstlerbezirk Brooklyn – der obdachlose Maurice eine neue Heimat in einem Underground-Club. Abends feiert hier in avantgardistischen Burlesque-Shows die Szene des Viertels ihre sexuelle Vielfalt. Tagsüber verdingt sich Maurice als Haushaltshilfe der neugewonnenen Wahlfamilie und als Kuschelopfer der beiden lesbischen Clubbetreiberinnen. Er selbst weiß nicht so recht, wohin es ihn eigentlich treibt, und spielt daher mit den Gefühlen eines Jungen, der sich in ihn verliebt hat.
Ganz anderen Aspekten der Sexualität widmen sich einige Dokumentarfilmer. Rosa von Praunheim rekapituliert in seinem semidokumentarischen Drama mit Interviewsequenzen und Spielszenen (unter anderem mit Hanno Koffler und Katy Karrenbauer) die Lebensgeschichte des ehemaligen Zuhälters und Schwerkriminellen Andreas Marquardt.
Vom Vater körperlich misshandelt, von der Mutter sexuell missbraucht findet Marquardt im West-Berliner Rotlichtmilieu ein Umfeld, in dem er sich eine extreme Form der Bestätigung erarbeitet. Sogar seine Lebensgefährtin quält er psychisch und physisch und beutet sie als Prostituierte aus. Erst durch eine Therapie während eines langjährigen Gefängnisaufenthalts gelingt ihm eine Art innere Läuterung.
Die Tschechin Veronika Lisková porträtiert in „Daniels World“ den Mittzwanziger Daniel. Der Literaturstudent und angehende Schriftsteller beweist den Mut, für diese Dokumentation sehr intime Einblicke in sein Gefühlsleben zu gestatten, und zwar ohne dass dabei sein Gesicht oder seine Stimme unkenntlich gemacht werden. Mutig ist das, weil Daniel offen darüber spricht, dass seine Liebe kleinen Jungs gilt.
Er weiß, dass er sein Begehren nie erfüllen darf und sich mit sexuellen Fantasien begnügen muss. Doch er wünscht sich von der Gesellschaft, wegen seiner sexuellen Identität nicht verachtet und ausgegrenzt zu werden – und wagt deshalb den Schritt an die Öffentlichkeit. Lisková filmt ihn unter anderem bei einem Treffen mit anderen jungen Pädophilen, beim Gespräch mit seinem Bruder und bei der Gay Pride Demo in Prag.
Für den Zuschauer ist diese betont gelassen daherkommende Dokumentation, die allein die Statements und Bilder sprechen lässt, in jeder Hinsicht eine Herausforderung. Umso überraschender, dass dieser Film vom tschechischen Fernsehen koproduziert wurde.
Einer Film- und Schwulenikone widmet sich Christian Braad Thomsen. Im Zentrum von „Fassbinder – Lieben ohne zu fordern“, einem sehr persönlichen Porträt des 1982 verstorbenen Filmemachers und Dramatikers, steht ein bislang unveröffentlichtes Interview, das der dänische Filmhistoriker Thomsen 1978 beim Filmfestival in Cannes geführt hat.
Mit eigenen Erinnerungen, dokumentarischem Material und aktuellen Interviews mit Menschen aus dem engeren Fassbinderkreis (unter anderem Irm Hermann und Harry Baer) entwickelt Thomsen ein erhellendes Psychogramm und widmet sich dabei auch Fassbinders Männerbeziehungen.
Ob Thomsen dafür den Teddy Award für den besten Dokumentarfilm des Festivals bekommen wird? Die neunköpfige Fachjury des weltweit bedeutenden queeren Filmpreises wird die Gewinner erst bei der Verleihung am 13. Februar bekanntgeben.