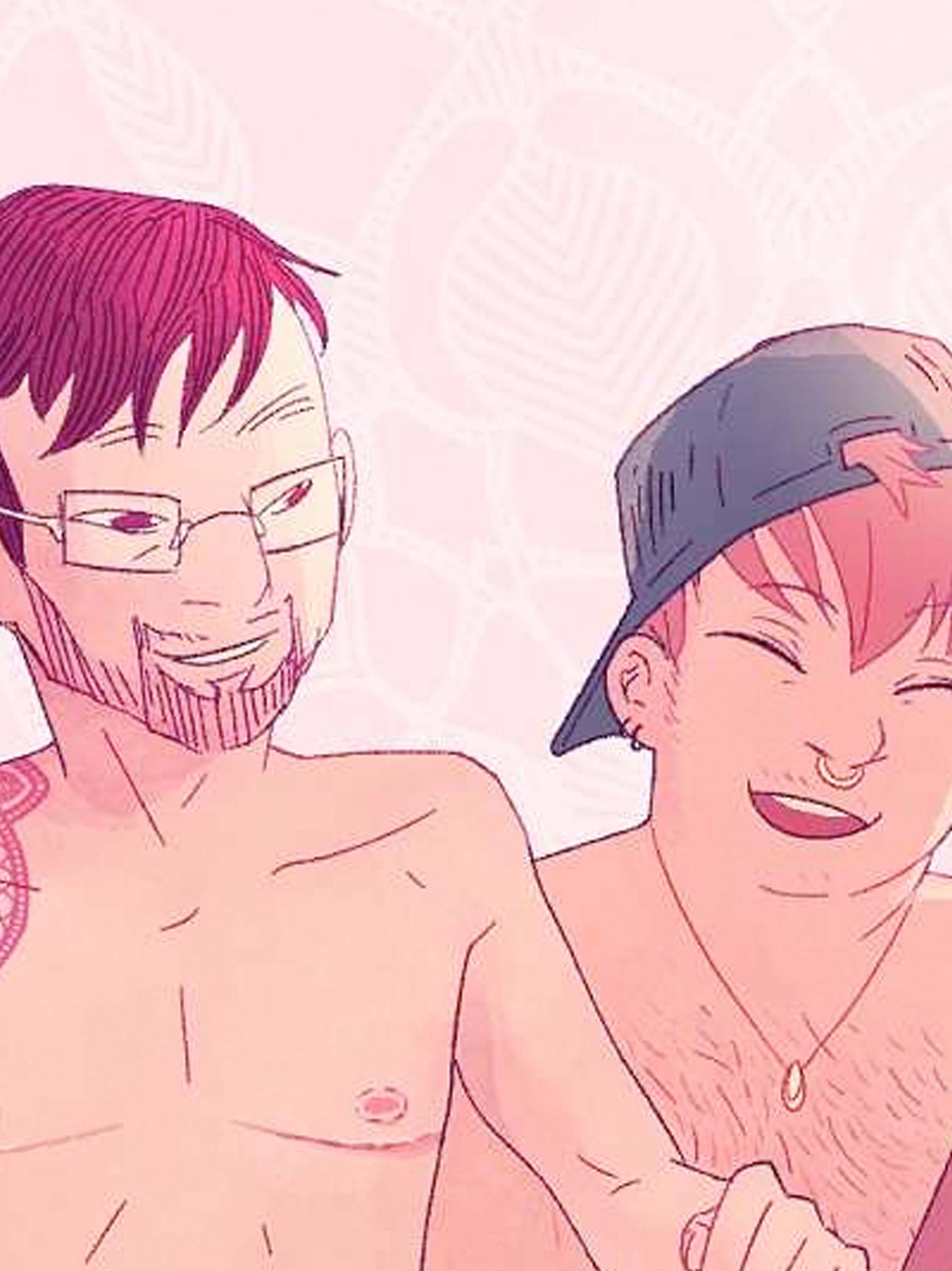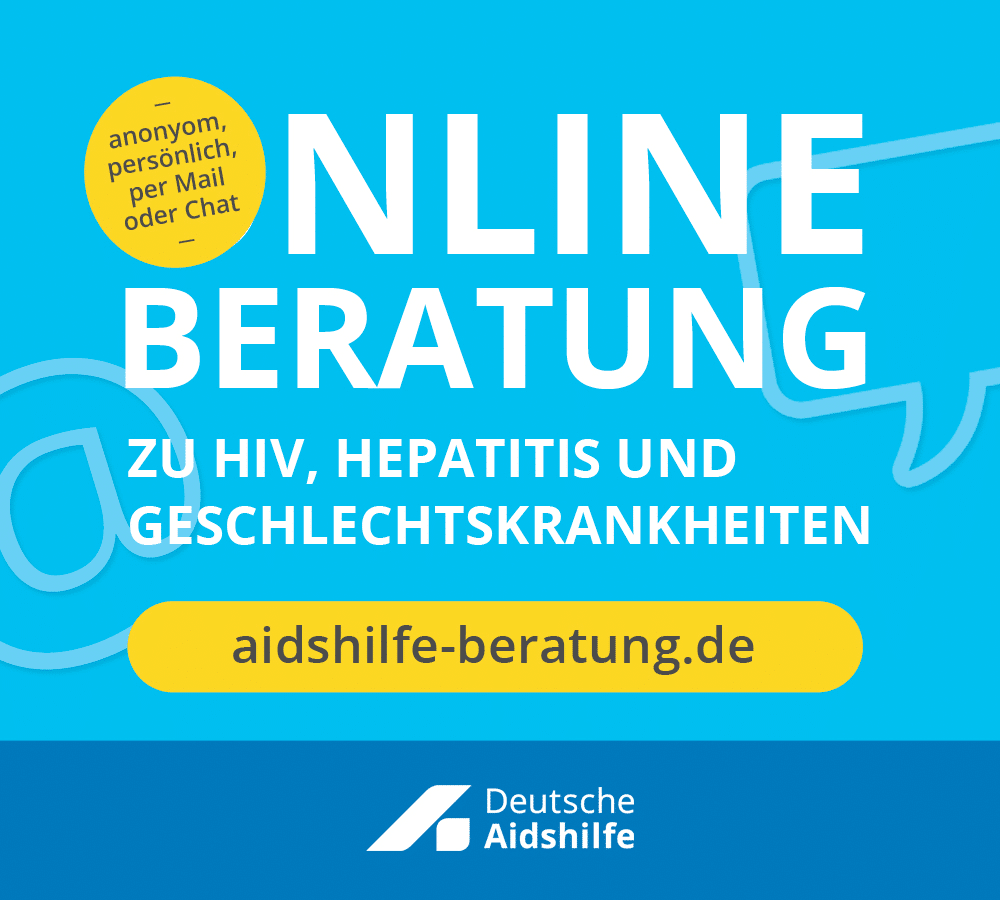„Moonlight“ ist verdientermaßen als bester Film mit dem Oscar ausgezeichnet worden. Barry Jenkins’ Drama über die Identitätssuche eines schwulen schwarzen Mannes ist ein Meisterwerk und ein Meilenstein.
Wenn es derzeit einen Film gibt, für den sich der Weg ins Kino wirklich lohnt, dann ist das „Moonlight“. Geht in Begleitung, denn ihr werdetdanach mit jemandem darüber sprechen wollen! Meidet soweit möglich die deutsche Synchronfassung (denn die ist ein Verbrechen)! Und macht euch darauf gefasst, dass euch die Stimmung, die Bilder, die Gesichter und Dialoge noch Tage danach beschäftigen werden.
„Moonlight“ ist der Beweis dafür, dass im Kino tatsächlich auch heute Überraschungen und Wunder zu erleben sind. Einer kleinen Independent-Produktion – der Erstlingsfilm eines bislang unbekannten Regisseurs, mit durchweg unbekannten und ausnahmslos schwarzen Schauspielern – ist gerade dabei, Kinogeschichte zu schreiben. Das Coming-of-Age-Drama gilt schon jetzt als Meilenstein in der Darstellung des schwarzafrikanischen Amerika, sondern auch des schwulen Kinos.
Ein sentimentales Sozialdrama?
Regisseur Barry Jenkins erzählt in „Moonlight“ von Heranwachsen in einem Armenviertel von Miami. Armut, Gewalt und Drogen prägen den Alltag und zeichnen scheinbar unausweichlich den Lebensweg vor. Klassischer Stoff also für ein sentimentales Sozialdrama mit den bekannten und bewährten stereotypen Figuren.
Auch in „Moonlight“ gibt es den angsteinflößenden Drogenboss, die kleinen Straßendealer mit der Hoffnung auf den Aufstieg. Und es gibt die crackabhängige Mutter, die kaum für sich selbst, geschweige denn sich um ihren Jungen kümmern kann. Jenkins aber, dessen Drehbuch auf dem autobiografischen Theaterstück des schwulen Autors Tarell McCrane basiert, wiederholt weder altbekannte Klitsches, noch tappt er in die Kitschfalle. Vielmehr gelingt es ihm, die Suche seiner Hauptfigur Chiron nach der eigenen Identität und einem Platz in dieser Welt so wahrhaftig zu schildern und damit eine Intimität zu schaffen, dass einem als Zuschauer immer wieder der Atem stockt.
Offene Gewalt und erstmal Zuneigung
„Moonlight“ verfolgt der Entwicklung Chirons ins drei Etappen seines Lebens: Schon als Neunjähriger (Alex Hibbert) wird er von seinen Mitschülern zum Prügelknabe erkoren und als „Faggot”, also Schwuchtel beschimpft – lange bevor er weiß, was das Wort bedeutet und er sich selbst seines Schwulseins bewusst ist. Die Ironie des Schicksals ist, dass er ausgerechnet in dem verständnisvollen Juan eine Art Ersatzvater und Mentor findet, denn Juan ist auch der Dealer von Chirons alleinerziehender Mutter (Naomie Harris). Doch auch in der Highschool ändert sich die Lebenssituation von Chiron (nun gespielt von Asthon Sanders) kaum. Das Mobbing in der Schule hat sich vielmehr in offene Gewalt gesteigert. Zugleich aber erlebt er mit seinem Mitschüler Kevin (Jharrel Jerome) während einer gemeinsamen Nacht am Strand erstmals Zuneigung und gegenseitige erotische Anziehung. Doch dann eskaliert die Situation…
Im dritten Teil ist Chiron (jetzt dargestellt von Ex-Sportler und neuerdings Calvin-Klein-Model-Trevante Rhodes) kaum mehr wiederzuerkennen. Der schmächtige Junge von einst hat sich nun einen Panzer aus Muskeln zugelegt und ist in die Fußstapfen seines einzigen männlichen Vorbildes Juan getreten. Die Oberarme sind so aufgepumpt, dass sie das T-Shirt zu sprengen drohen, um den Hals blinkender Goldschmuck, das Auto ein protziger Dealerschlitten.
Wie ein Schlag in die Magengrube
Das überraschende Wiedersehen mit seinem einstigen Schulfreund Kevin verspricht eine hoffnungsvolle Wendung. In einem der üblichen schwulen Coming-of-Age-Filme käme nun das Happy End mit langem Kuss und Sprung in die Kiste. Aber auch hinter konterkariert „Moonlight“ die standardisierten Erzählmuster. Stattdessen: ein einziger Satz – ganz leise, mit zitternder Stimme ausgesprochen – sprengt nicht nur Chiron Schutzpanzer aus Muskelmasse und Macho-Pose. Dieser Satz wirkt wie ein Schlag in die Magengrube und geht zugleich mitten ins Herz. Er und hallt noch lange, lange nach.
Atemberaubende, unvergessliche Bilder
Das Großartige an „Moonlight“ ist, dass es viele solcher Szenen gibt. Es sind intime, geradezu zarte Momente, in denen Körperhaltungen und Gesten, in denen das Schweigen oder auch der zutiefst traurige Blick des um Selbstbewusstsein ringende Chiron mehr von dessen Einsamkeit und Schmerz vermitteln, als es jeder ausschweifende Dialog könnte. Daneben gelingt es Jenkins, gleich eine ganze Reihe keineswegs leichter Themen alles andere als oberflächlich zu behandeln – fragwürdige Männlichkeitsideale und Vorbilder genauso, wie schwule Selbstfindung, homophobe Gewalt und Mobbing – ohne dabei plakativ oder oberlehrerhaft zu geraten. Jenkins beweist sich dabei als ein derart versierter Regisseur, dass er dafür nicht nur atemberaubende, unvergessliche Bilder findet, sondern auch ganz große Gefühle ganz unsentimental zu darzustellen vermag. Ganz zu Recht wurde das Kreativteam wie auch das beeindruckende Schauspielerensemble mit inzwischen über 180 (!) Auszeichnungen belohnt.
„Moonlight“, USA 2016. Regie: Barry Jenkins, mit Ashton Sanders, Trevante Rhodes, Alex R. Hibbert, Mahershala Ali, Janelle Monáe. Kinostart: 9. März – zum Trailer: Klick hier