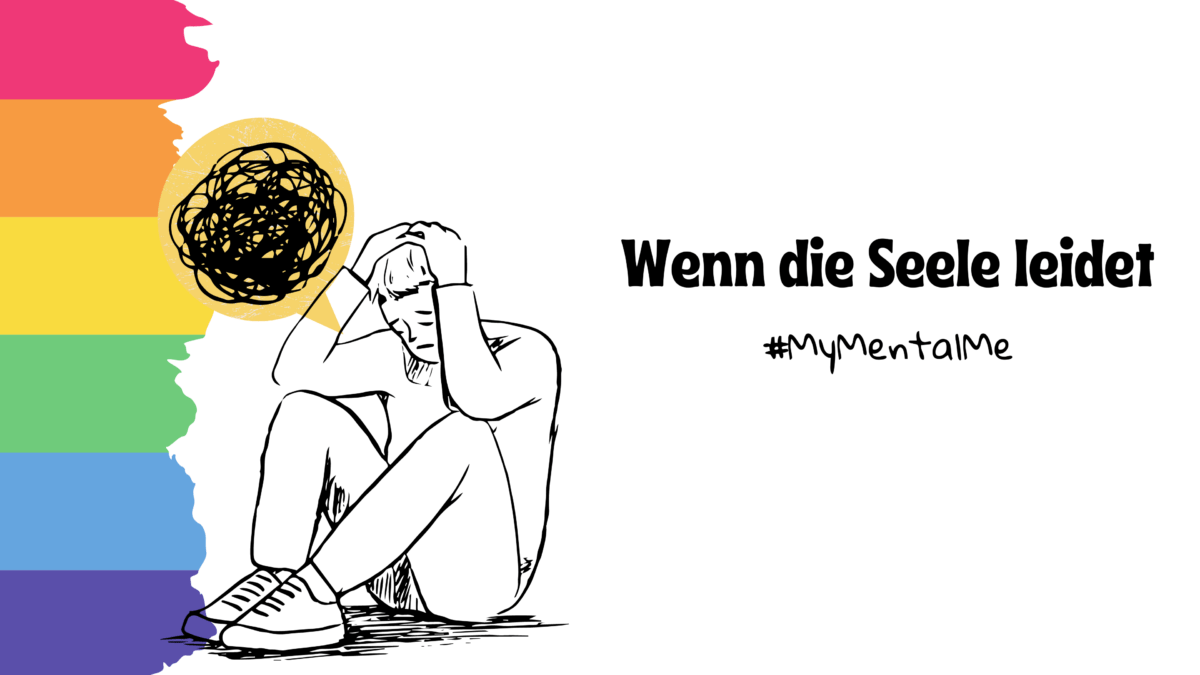Triggerwarnung: In diesem Artikel geht es um psychische Erkrankungen, Depressionen, Angstzustände, Substanzkonsum, Essstörungen und Suizid. Wenn das etwas ist, was dich belasten könnte, dann verzichte auf diesen Artikel oder lese ihn mit Vorsicht.
Die Anzeichen reichen von Schlafstörungen, Angstgefühlen und Stimmungsschwankungen bis hin zu unkontrolliertem Alkohol- und Drogenkonsum. Nicht immer muss eine psychische Erkrankung dahinterstecken. Solche negativen Gefühle und mentale Ausnahmesituationen können lediglich vorübergehend, allerdings auch Vorboten einer größeren Krise sein. Nicht zuletzt infolge von Corona hat die Zahl der Menschen, um deren psychische Gesundheit es nicht gut bestellt ist, zugenommen. Dennoch wird viel zu wenig darüber gesprochen, auch innerhalb der queeren Szene. Dabei sind gerade queere Menschen im besonderen Maße betroffen. So sind beispielsweise Einsamkeit sowie Angst- und Schlafstörungen bei LGBTIQ überproportional verbreitet, wie eine 2021 veröffentlichte Studie der Universität Bielefeld zeigt. Demnach erkranken queere Menschen im Laufe ihres Lebens zweieinhalbmal so häufig an Depressionen wie heterosexuelle.
Darüber hinaus leiden insbesondere junge schwule Männer verstärkt an Essstörungen, weiß der Berliner Psychologe Marcus Behrens.
In der eigenen negativen Gefühls- und Gedankenwelt verfangen
Er erlebt bei den Beratungen in seiner eigenen Praxis bzw. im Checkpoint Mann-O-Meter schwule Männer, die von Selbstzweifeln und Minderwertigkeitsgefühlen geplagt sind, die unter einer anhaltenden gedrückten Stimmung leiden, in endlosen Grübeleien verfangen sind oder sogar an Suizid denken. „Bisweilen ist diese negative Gefühls- und Gedankenwelt schon so sehr Teil der eigenen Persönlichkeit geworden, dass sie nicht mehr oder zu spät als Problematik erkannt wird“, sagt Behrens.
Ganz ähnlich erlebt es sein Kollege Martin Heinze von der queeren Beratungsstelle Rubicon in Köln. Seit mittlerweile drei Jahrzehnten bietet der Diplom-Pädagoge ein offenes Ohr, Rat und Hilfe. Die Probleme, weswegen die Menschen zu ihm kommen, seien über diese lange Zeit im Prinzip gleichgeblieben.
Denn LGBTIQ sind besonderem Stress ausgesetzt. Auch wenn sich die Lebensbedingungen hierzulande deutlich verbessert haben: die Erkenntnis, anders zu sein als die anderen, kann – gerade bei jungen Menschen – immer noch sehr belastend sein. Zudem ist die eigene Auseinandersetzung mit sexueller Identität und Orientierung weiterhin häufig mit Leid und Diskriminierung verbunden, aber auch mit Scham, Ängsten und verinnerlichter Selbststigmatisierung.
Schwul, lesbisch, trans* oder bi zu sein bedeutet auch, sich letztlich ein Leben lang immer wieder outen zu müssen, etwa gegenüber neuen Freund*innen oder Arbeitskolleg*innen. Das heißt damit auch, immer wieder die Risiken und möglichen Reaktionen abwägen oder sich gar verstellen zu müssen. Oder man bewegt sich in der Öffentlichkeit stets sehr kontrolliert – aus Angst als schwul identifiziert und deshalb beleidigt oder gar tätlich angegriffen zu werden.
Wenn Stress krank macht
„Wir haben alle Stress im Leben, auch der heterosexuelle weiße cis Mann. Bei Minderheiten aber kommt immer noch eine Schippe drauf“, erläutert Marcus Behrens.
„Wenn ein heterosexueller Mann in den Urlaub fährt, muss er sich bei der Buchung nicht die Frage stellen, ob er im Reiseland wegen seiner sexuellen Orientierung möglicherweise angepöbelt oder sogar festgenommen werden könnte.“
Die Sozialwissenschaften haben für diese besondere Form der psychischen Belastung den Begriff „Minderheitenstress“ geprägt. Ihm sind nicht nur LGBTIQ, sondern etwa auch Menschen mit Migrationsgeschichte, BIPoC oder arme, sozial benachteiligte Menschen ausgesetzt.
Doch während beispielsweise Schwarze Menschen meist in einer Familie mit anderen BIPoC aufwachsen und so zumindest in dieser Familie in ihrer Identität gestärkt werden können, ist dies bei LGBTIQ in der Regel nicht der Fall. Diesen Stress bewältigen zu müssen, stellt eine eine enorme Belastung dar und ist auf Dauer nicht gesund. „Wenn mein Immunsystem gut ist, gelingt es dem Körper leichter ein Grippevirus abzuwehren, als wenn es geschwächt ist“, erklärt Marcus Behrens.“ Vergleichbares gilt für die Seele. Wenn mir alles zu viel wird und ich das alles nicht mehr aushalte, besteht die Gefahr, dass ich krank werde.
Nicht alle Aspekte schwulen Lebens tun immer gut
Auch die schwule Community kann übrigens stressig sein und sich negativ auf das psychische Wohlbefinden niederschlagen. Der Umgang in der realen wie virtuellen Szene ist nicht immer gerade freundlich und unterstützend. Wenn man in der Bar oder in der Sauna übersehen wird und keinen Kontakt findet, kann das auf Dauer ziemlich aufs Gemüt schlagen. „Auf Planetromeo, Grindr und Co. wiederum muss ich mir bewusst sein, dass es zumeist nur um attraktive Bilder geht, und gar nicht wirklich um mich“, sagt Marcus Behrens. Zum Glück aber es gibt nicht die eine Community. „Wenn mir die Datingplattformen Stress machen, muss ich mir möglicherweise andere Orte suchen, um mit anderen in Kontakt zu kommen.“
Männer kann man zum Glück auch jenseits sexueller Szeneorte und Dating-Apps kennenlernen, etwa in Selbsthilfegruppen, queeren Vereinen und Organisationen oder auf Online-Plattformen, bei denen nicht der Sexkontakt an erster Stelle steht.
Denn Freundschaften und enge Bekanntschaften sind enorm wichtig für die seelische Gesundheit.
„Auch wenn es schwerfällt: Es ist wichtig, sich Luft zu machen“
„Es ist bereits sehr hilfreich, eine gute emotionale Beziehung zu einer einzigen anderen Person zu haben – seien es ein guter Kumpel, die beste Freundin oder ein Elternteil“, sagt Marcus Behrens. „Menschen, bei denen ich mich geborgen und ein Stück weit zuhause fühle, denen ich mich gegenüber öffnen kann und über Dinge reden kann. Mit denen ich offen über Schwächen und Gefühle, auch über die negativen, sprechen kann. Das müssen nicht nur queere Menschen sein, aber es sind idealerweise gute Verbündete, die die eigene Lebensart widerspiegeln.“
„Auch wenn es schwerfällt: Es ist es wichtig, sich Luft zu machen“, bestätigt Jonathan Gregory. „Deshalb braucht es zumindest eine Person, bei der man sich sicher fühlt und bei der man sich öffnen, mitteilen und anvertrauen kann: ‚Mir geht es gerade nicht so gut. Mich belastet etwas‘“. Jonathan Gregory ist seit 2023 Teil des neu aufgestellten Teams von ICH WEISS WAS ICH TU. Als deren Leiter ist es ihm eine Herzensangelegenheit, mentale Gesundheit zum zentralen Thema der schwulen Präventionskampagne zu machen.
Denn eine psychische Erkrankung kann jeden treffen. Das hat Gregory 2022 selbst erfahren müssen, als er wegen einer schweren Depression für vier Monate eine Tagesklinik aufsuchen musste.
„Anfangs war ich mir unsicher, ob dies für mich als Schwarzer schwuler Mann tatsächlich ein Ort ist, an dem ich gesunden kann. Werde ich dort als der wahrgenommen und aufgenommen, der ich bin? Das sind Fragen, die sich Heteros nicht stellen müssen“, sagt Gregory. Seine Bedenken aber waren schnell verflogen „Ich habe dann die positive Erfahrung gemacht, dass ich dort nicht die einzige queere Person war und ich auch die Hilfe bekommen habe, nach der ich gesucht hatte.“
Hilfe zu suchen, ist keine Schwäche, sondern mutig
Sich bewusst zu werden, dass es einem nicht gut geht, dass man Unterstützung benötigt und sie auch annehmen möchte, ist ein erster, sehr bedeutsamer Schritt. Um professionelle Hilfe bemühen sollte man sich dann, wenn man sich mehr und mehr in Gedankenschleifen verfängt, längerfristig an Schlafproblemen leidet oder man negative Gefühle beispielsweise durch übermäßigen Porno- oder Alkoholkonsum oder reihenweise Sexdates zu kompensieren versucht. „Wenn ich das Gefühl habe, dass ich dies nicht mehr selbst steuern kann, sondern davon gesteuert werde, kann dies ein wichtiges Indiz für eine psychische Krise sein“, erläutert der Rubicon-Berater Martin Heinze.
Eine längerfristige therapeutische Begleitung oder gar ein Krankenhausaufenthalt sind jedoch nur bei schweren psychischen Erkrankungen notwendig.
Um aus einem seelischen Tief herauszukommen, sind Beratungseinrichtungen gute Anlaufstellen. Sie können bei Bedarf dann auch an queer-erfahrene Psycholog*innen vermitteln.
„Mir hat sehr geholfen, festzustellen, dass andere ganz ähnliche Erfahrungen im Zusammenhang mit Depression und psychischer Gesundheit gemacht haben, wie ich“, sagt Jonathan Gregory. Deshalb ist der Austausch mit anderen Schwulen – ob auf privater Ebene oder in Selbsthilfegruppen – eine wichtige Hilfe.
„Ich kann die Bettdecke über den Kopf ziehen und zuhause bleiben, das ist durchaus auch mal o.k.“, sagt Martin Heinze. „Doch es ist wichtig, dass es mir gelingt, mich darüber hinaus mit den Dingen auseinanderzusetzen, die mich belasten“. Wenn dies im Alleingang nicht gelingt, ist es wichtig, sich nicht zuhause zu vergraben, aus der Welt zurückzuziehen, sondern Kontakt zu anderen aufzunehmen. Das können eine professionelle Unterstützung durch eine*n Therapeut*in oder Gespräche mit Freund*innen sein.
Marcus Behrens rät, sich allein oder im Austausch mit den eigenen Bedürfnissen und Gefühlen und dem eigenen Befinden auseinanderzusetzen – und auf sich selbst zu achten. Womöglich nimmt man dann so erst wahr, was man sich bislang noch nicht eingestanden hat: dass man sich vielleicht einsam fühlt oder unkontrolliert Alkohol und Drogen konsumiert.
Genauso wichtig: sich selbst mit allen Schwächen, Defiziten aber auch guten Eigenschaften anzunehmen. Wie verhalte ich mich und tut mir das wirklich gut? Halten mich meine Gewohnheiten vielleicht in dieser Situation anstatt dass sie mich hinausführen?
Statt vor bestehenden Problemen zu resignieren, ist es besser nach Lösungen zu suchen: Was kann ich selbst tun? Was würde die Situation verbessern? Wer könnte mich dabei unterstützen oder welche Hilfe könnte ich in Anspruch nehmen?
Das Schöne im Leben wiederentdecken
Gregory hat aus seiner Therapie eine kleine Übung in seinen Alltag übernommen und gönnt sich seither jeden Tag eine kleine Auszeit. „Ich gebe mir zwei, drei Minuten, um die Augen zu schließen, mich ganz auf mich zu fokussieren und in mich hineinzuhören. Und auf diese Weise auch Stress abzubauen.“
Um nicht nur das Belastende, sondern auch die schönen Dinge im Leben zu sehen, überhaupt wahrzunehmen, empfiehlt Marcus Behrens eine andere Übung: Jeden morgen steckt man fünf Steinchen oder andere kleine Gegenstände in eine Hosentasche. Im Laufe des Tages packt man bei jedem schönen Erlebnis eines in die andere Hosentasche. „Diese Anlässe können Kleinigkeiten sein: ein schönes Telefonat, ein gutes Essen, eine freundliche Begegnung im Supermarkt“, erläutert Behrens. Abends wird man jedoch feststellen, dass es doch viel Gutes an diesem Tag gab.“ „Zudem kann man auf diese Weise das Gehirn ein wenig erziehen, dass es nicht immer nur Dinge registriert, die nicht funktionieren oder die mir Sorgen machen, sondern das Gute im Alltag und die Dinge, an denen ich Freude hatte.“
Freude kann man sich aber auch ganz gezielt bereiten. Indem man sich entsprechende Dinge vornimmt: Sich etwas Schönes zu essen zu kochen oder (wenn man über genügend Geld verfügt), sich einen Restaurantbesuch zu gönnen. Sich mit Freunden zu treffen, einen Spaziergang im Park zu machen, die öffentliche Bibliothek zu besuchen, zu malen oder etwas zu basteln.
„Hey, wie geht’s dir gerade?“
Und nicht zuletzt kann jede*r dazu beitragen, dass es anderen Menschen besser geht. Die einfache Frage „Wie geht es dir?“ kann schon sehr viel helfen – wenn man diese Frage auch ernst meint und man der Person den Raum gibt, darauf auch ehrlich antworten zu können.
„Wir können das psychische Wohlbefinden als queere Community nur gemeinsam stärken, indem wir aufeinander achten und wir uns bewusst machen, dass es ein Aspekt ist, der uns in allen Lebensbereichen begleitet“, sagt Jonathan Gregory. „Und wenn wir nicht davor zurückscheuen, ehrlich zu uns zu sein und die Belastungen, denen wir ausgesetzt sind, auch anzusprechen.“ IWWIT möchte dazu im Laufe des Jahres mit Kampagne „#MyMentalMe“ einen kleinen Beitrag leisten und nicht zuletzt auch für mehr Sichtbarkeit des Themas in der queeren Community sorgen.